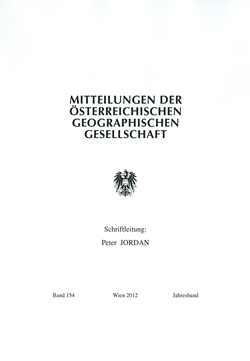
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft Band 154/2012, pp. 235-260, 2013/01/30
154. Jg. (Jahresband), Wien 2012
Phnom Penh bietet nach der Vertreibung der Roten Khmer eine singuläre Fallstudiezur Untersuchung der Verräumlichungsprozesse von Geschäfts- und Gewerbestandortenals spontanen Prozess. Die Bewohner einer Millionen-Metrople wurden 1975 von PolPot zwangsvertrieben. Erst Jahre nach dieser „Stunde Null“ einer sozialen tabularasa konnte die Stadt ihr urbanes Leben von Grund auf neu starten. Dieser Beitragnimmt diese Startsituation zur Grundlage, um die Neu- und Wiederpositionierung vonGeschäftsstandorten hinsichtlich ihrer räumlichen Genese zu untersuchen. Der Schwerpunkthierbei liegt auf der Frage, ob der Prozess der Standortentscheidungen einemverallgemeinerbaren oder einem spezifischen Muster im Zuge einer Reurbanisierungentspricht. Die Ergebnisse zeigen, dass Phnom Penh (a) zwar in diesem Umfang einenstädtischen Sonderfall repräsentiert, der Standortentscheidungen mit Pfadabhängigkeitund Persistenzen aufweist; doch zeigt Phnom Penh auch, wie (b) zahlreicheindividuelle Standortentscheidungen zu hoher Markttransparenz führten: Diese sindnicht-intentionale Folgen der Selbstagglomeration (economies of agglomeration).