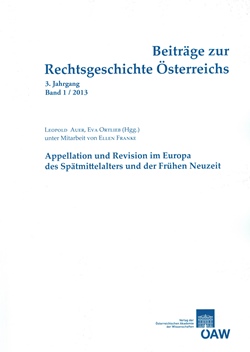
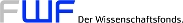
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 1 / 2013, pp. 121-146, 2013/05/21

Der Beitrag gibt Einblicke in den Wiener Gerichtsalltag in zivilrechtlichen Appellationsangelegenheiten am Beispiel des Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises. Erstmals wird anhand der archivalischen Überlieferung ein Grundgerüst des zivilrechtlichen Appellationsverfahrens beschrieben. Drei Aspekte kristallisieren sich anhand der empirischen Befunde beim gegenwärtigen Forschungsstand heraus. Erstens: Der reichshofrätliche Appellationsprozess glich im vorliegenden Untersuchungszeitraum 1648 bis 1657 dem kameralen Rechtsmittelverfahren. Zweitens: Im Rahmen der normativen Vorgaben (bspw. Reichskammergerichtsordnung und Jüngster Reichsabschied) bestimmten die Konfliktparteien als „Herren“ des Verfahrens über dessen Ablauf und Fortgang. Der Reichshofrat agierte primär nur auf Ansuchen der Kontrahenten, jede reichshofrätliche Verfügung musste durch die Parteien beantragt werden. Erließ der Reichshofrat eine Verfügung, so waren die Parteien verpflichtet, diese umzusetzen. Die starke Position der Parteien eröffnete Spielräume, aus denen eine gewisse Offenheit des Verfahrens resultierte. In diesem Procedere wirkt der Reichshofrat in weiten Teilen eher als Vermittler. Seine wiederholte Bereitschaft, abgeurteilte Sachverhalte neu zu verhandeln, verstärkt diesen Eindruck. So wirkt – drittens – die Gerichtstätigkeit des Reichshofrats auf den modernen Betrachter widersprüchlich und zurückhaltend, wofür verschiedene Erklärungsansätze ins Feld geführt werden können: Eine primär auf Konsens und weniger auf Rechtssicherheit und -eindeutigkeit ausgerichtete frühneuzeitliche Konfliktmentalität, die unüberschaubare Vielfalt der Rechtszugänge und Gerichtsobservanzen, die Verflechtung der Rechtsprechung mit politischen und herrschaftlichen Machtinteressen sowie eine angesichts hoher Inanspruchnahmezahlen wohl nicht zu bezweifelnde große Arbeitsbelastung der Reichshofräte.