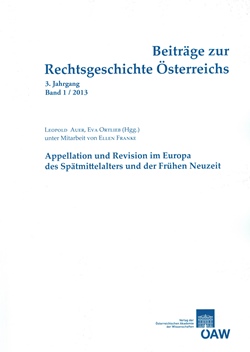
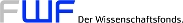
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 1 / 2013, pp. 211-230, 2013/05/21

Der Große Rat entstand im 15. Jahrhundert nicht nur als ein Appellationsgericht, sondern er verfügte auch über eine vielseitige erstinstanzliche Zuständigkeit. Darüber hinaus gab es verschiedene andere Rechtsmittel, durch welche man eine Rechtssache vor den Rat bringen konnte (z. B. Opposition, Reformation, Revision). Als Appellationsgericht war der Rat grundsätzlich für die Überprüfung von Entscheidungen der Provinzialhöfe zuständig. Allerdings gab es eine Vielzahl von Ausnahmen, so dass auch Urteile unterer Gerichte (z.B. Stadtgerichte) direkt vor dem Rat angefochten werden konnten. Das Appellationsverfahren entsprach im 15. Jahrhundert im Wesentlichen dem Muster des gelehrten römischkanonischen Verfahrensrechts, wurde in der burgundischen Zeit aber auch durch die französische Praxis, insbes. die des Pariser Parlement, beeinflusst. Daneben entwickelte der Rat allmählich seinen eigenen „Stil“. Sein Verfahren wurde darüber hinaus durch die fürstliche Gesetzgebung (insbes. des späten 15. und des 16. Jahrhunderts) geregelt. Obwohl das Appellationsverfahren in der Regel die Überprüfung des angefochtenen Urteils aufgrund der Akten der Vorinstanz vorsah (ex eisdem actis, an bene vel male iudicatum sit), zeigt die Praxis, dass die Parteien, insbes. durch das Mittel der requête-civile, Abweichungen vom ordentlichen Prozessverlauf erreichen konnten. Auf diese Weise wurde u.a. das Vorbringen neuer Tatsachen einschließlich einer eigenen Beweisführung möglich. Damit näherte sich das Appellationsverfahren in der Praxis teilweise dem erstinstanzlichen Prozess an.