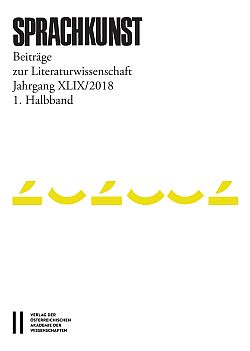
Sprachkunst Jahrgang XLIX/2018, 1. Halbband, pp. 5-26, 2019/04/18
Beiträge zur Literaturwissenschaft
Jahrgang XLIX/2018, 1. Halbband

Der Aufsatz stellt eine textnahe Lektüre der Entwürfe und Druckversionen von Johann Joachim Winckelmanns (1717–1768) Beschreibung des ›Torso von Belvedere› vor. Es soll gezeigt werden, wie Winckelmann dort die Grundlagen dafür beschreibt, wie die Antike sich vererbt. Mit Rekurs auf etymologische (thyrsos als ‚„abgeschnittenes Stück“) und rhetorische (der Torso als Metonymie) Aspekte der Beschreibungen wird deutlich, dass der Torso für Winckelmann nicht nur abstrakte Historizität exponiert, sondern das Erinnern und Anerkennen einer Vergangenheit, die einerseits unwiederbringlich und beklagenswerter Weise vergangen, andererseits auf radikale Weise „unsere“ Vergangenheit ist, d.h. verpflichtendes Erbe. Das berühmte allegorische Ende von Winckelmanns ›Geschichte der Kunst‹ (1764) reflektiert dies insofern, als dort erklärt wird, wie Pathos und Ethos erst in ihrem Zusammentreffen die entscheidende Rolle für das Erbe der Antike sind.